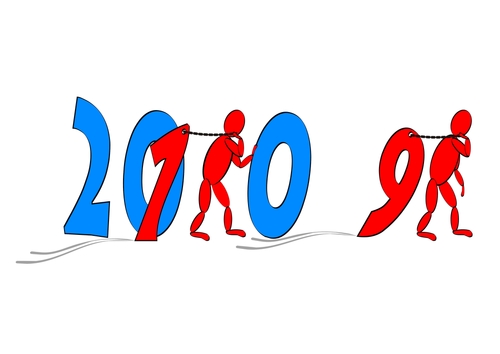Eine Leseprobe aus meiner Geschichte „Das Über-Ich“, die in der Geschichtenweber-Anthologie „Optatio Onyx – Wünsche des Verderbens“ im Web-Site-Verlag erschienen ist.
Adrian fehlen vor allem zwei Dinge: Selbstbewusstsein und Durchsetzungskraft. Darüber hinaus glänzt er nur durch Schüchternheit. Als er sich durch ein Kaufhaus in Frankfurt schleicht, um die Bedürfnisse seiner geschenksüchtigen Frau zu befriedigen, wird er fast von einem Mann überrannt, der vor einer Rockerbande flüchtet.
Adrian findet einen geheimnisvollen Armreif, den vermutlich der Verfolgte verloren hat. Von nun an wird sich sein Leben gründlich ändern.
*********************************************************************
Adrian begann den Haufen nutzlosen Krams zu durchsuchen, der sich zu Schleuderpreisen vor ihm auftürmte: bunte Kämme, grüne und rote Plastikbecher, Haarspangen in allen Farben … Nichts davon taugte auch nur annähernd für den erwarteten Liebesbeweis. Dann sah er diesen schwarzen Stein zwischen der Billigware glänzen. Er griff danach und zog einen Armreif hervor. Das war es wohl, was dem armen Mann vom Handgelenk gefallen war. Er sah ein wenig zu wertvoll aus für einen Wühltisch: ein schwarzer halbmondförmiger Stein mit weißen Verzierungen. Adrian kannte sich mit Schmuck nicht aus und hatte keine Ahnung, um welche Art Stein es sich handeln könnte. Nur wusste er, dass er ihn eigentlich seinem Besitzer zurückbringen müsste. Als er an den Verfolgten dachte, fröstelte ihn.
Er strich mit dem Finger über den Reif und ein leichtes Kribbeln breitete sich in seiner Hand und dann in seinem Arm aus. Vielleicht sollte er erst einmal sicher gehen, ob der Armreif nicht doch schon hier gelegen hatte. Er ging zur nächstgelegenen Kasse und stellte sich ans Ende der Schlange.
»Entschuldigung?«
Die Kassiererin hatte sich, als er an der Reihe war, zu einer Kollegin umgedreht und begonnen über ein Telefonat mit ihrem Liebsten zu erzählen. Jetzt drehte sie sich zu ihm um und musterte ihn genervt.
»Entschuldigen Sie bitte, ich will wirklich nicht lange stören. Ich wollte nur fragen, ob dies hier«, er zeigte den Armreif vor, »zu Ihrem Sortiment gehört.«
»Wo haben Sie es denn gefunden?«
»Dort auf dem Wühltisch.«
Die Kassiererin zögerte einen Moment, ließ den Blick ihrer rehbraunen Augen noch einmal an Adrian heruntergleiten, strich dann ihr blond gefärbtes Haar zurück und sagte: »Natürlich gehört das zu unserem Sortiment.«
»Es ist nur, weil kein Preisschild dran war.« Seine Stimme wurde immer leiser. Er fingerte am Gestell seiner Brille herum. »Und dann war da dieser Mann, der …«
»29,99.«
»Wie bitte?«
»Es kostet neunundzwanzig Euro und neunundneunzig Cent.«
Die Kollegin der Kassiererin versuchte ein Kichern zu unterdrücken.
»Sind Sie sicher?«
»Wollen Sie es nun kaufen oder nicht?« Die Verkäuferin machte Anstalten, sich wieder umzudrehen.
»Hier wollen auch noch andere Leute einkaufen«, hörte Adrian eine keifende Stimme hinter sich. Er drehte sich gar nicht erst nach ihrer Besitzerin um, kramte das Portemonnaie aus der Innentasche und zählte dreißig Euro auf den Kassentisch. »Stimmt so, vielen Dank.«
Warum war er nur immer so ein Weichei? Er wünschte sich in diesem Moment nichts sehnlicher, als wenigstens ein bisschen selbstbewusster zu sein. Er blieb stehen, drehte sich um, ging zurück. Diesmal stellte er sich nicht an. Und er sprach so laut, dass es die gesamte untere Etage hören musste.
»Wissen Sie, Sie können das Geld behalten. Kaufen Sie sich etwas Schönes dafür. Aber denken Sie nicht, ich hätte nicht bemerkt, dass Sie mich verarscht haben. Was sind Sie nur für eine erbärmliche Kreatur. Glücklicherweise komme ich nicht aus Frankfurt, denn bei Ihnen wollte ich sicher nicht noch einmal einkaufen!«
Er fühlte sich gut, fühlte sich … so hatte er sich noch nie gefühlt. Sicher, irgendwie. Stark, ein bisschen. Er störte sich nicht daran, was die Kaufhausangestellte jetzt von ihm dachte. Ihn störten auch die Blicke der anderen Kunden nicht, die ja nicht wissen konnten, warum er gerade so laut geworden war. Ja, er war laut geworden. Wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben. Und er konnte sich gar nicht erklären, warum.
Jedenfalls hatte er jetzt die richtige Kleinigkeit für Isabell. Natürlich wusste er, dass der Armreif eigentlich dem armen Verfolgten gehören musste. Doch selbst um den wollte er sich jetzt nicht weiter kümmern. Was ging ihn das Leid des Fremden an? Adrian hatte keine Lust, weiter durch Frankfurts Einkaufszentren zu latschen. Außerdem war er gerade dreißig Euro für den Armreif des Mannes losgeworden. Er hatte ihn also rechtmäßig erworben. Und er musste zum Bahnhof.
Er hatte eine Platzkarte für einen Sitz im Nichtraucherabteil am Fenster in Fahrtrichtung. Es war nicht ungewöhnlich, dass es Menschen gab, die darauf keine Rücksicht nahmen. Schon auf der Hinfahrt am Freitag hatte er seinen Platz einer dicken Frau überlassen müssen, weil er es einfach nicht übers Herz gebracht hatte, seinen Anspruch geltend zu machen. Diesmal saß ihm ein junger Mann etwa in seinem Alter im Weg und rauchte. Alle anderen Plätze waren noch frei, schließlich fuhr der Zug erst in knapp zwanzig Minuten.
»Guten Tag. Sie sitzen auf meinem Platz.«
Der Raucher blickte ihn amüsiert an. »Das tut mir leid. Aber vielleicht könnten Sie sich woanders hinsetzen? Es ist ja alles frei. Und mir wird schlecht, wenn ich nicht am Fenster sitzen kann«, sagte er, und als er dem Blick Adrians zum zweiten Fensterplatz folgte, fügte er noch hinzu: »In Fahrtrichtung.«
Adrian war ganz ruhig. »Sehen Sie, guter Mann: Eigentlich ist es mir scheißegal, ob Ihnen von Ihrem Platz oder Ihrer Zigarette schlecht wird. Solange es nicht auf dem Platz geschieht, den ich reserviert habe. Da sitze nämlich ich. Sie dürfen also aufstehen, das Fenster öffnen, Ihren Glimmstängel dort hinauswerfen, Ihre Sachen packen und sich einen anderen Fensterplatz in Fahrtrichtung suchen.«
Sein Gegenüber öffnete den Mund, fragte dann aber nicht einmal nach dem Beweis für die Reservierung und tat – in der vorgegebenen Reihenfolge – wie ihm geheißen.
Adrian war selbst verwundert über seine Worte. Doch er fühlte sich dabei sehr wohl. Wie schön wäre es, dachte er, wenn ich das Abteil bis Marburg für mich hätte.
Das war freilich sehr unwahrscheinlich, denn an der Reservierungstafel konnte er ablesen, dass auch die anderen fünf Plätze ab Frankfurt belegt waren. Immerhin schienen das auch die Fahrgäste zu akzeptieren, die sich nun in immer kürzeren Abständen an der Abteiltür vorbeischleppten. Doch als der Zug endlich anruckte, selbst als er den Frankfurter Bahnhof schon eine Weile verlassen hatte, waren die anderen Plätze noch immer nicht besetzt. Vielleicht sind meine Mitreisenden krank geworden, mutmaßte Adrian. Oder verstorben. Das nenne ich Glück. So lässt es sich reisen.
Tatsächlich blieb er bis Marburg allein. So ließ es sich auch verschmerzen, dass er überhaupt mit dem Zug fahren musste. Isabell hatte das Auto gebraucht, weil sie gestern Abend ihre Freundin Marla in Cölbe besuchen wollte. Cölbe! Dahin hätte sie auch zu Fuß gehen können. Während er zur Weiterbildung nach Frankfurt in den überfüllten Zug steigen musste, reiste sie die paar Kilometer in seinem Passat. Aber er ließ ihr ja immer ihren Willen, riss sich den Arsch auf für Madame. Doch damit sollte jetzt Schluss sein.
Bisher hatte er sich eingeredet, er könne froh sein, überhaupt eine solche Traumfrau geehelicht zu haben, und müsse ihr, allein um sie zu halten, jeden Wunsch von den Augen ablesen. Er war aus allen Wolken gefallen, als sie ihm – wenn auch ein bisschen beschwipst – vor genau zwei Jahren und zweihunderteinundzwanzig Tagen ihre Liebe eingestanden hatte, war er doch noch einen Tag zuvor im Glauben gewesen, er sei in der Herrenboutique des Lebens der Ladenhüter schlechthin.
Jetzt war er sich sicher, dass er sich bis heute eindeutig unter Wert verkauft hatte. War nicht Isabell der beste Beweis dafür, dass er gar nicht so ein unattraktiver Kerl sein konnte? Musste sie nicht eigentlich froh sein, jemanden wie ihn ergattert zu haben?
Der Zug fuhr auf dem Marburger Bahnhof ein. Adrian wartete nicht wie üblich, bis sich alle anderen Fahrgäste, die hier aussteigen wollten, an seinem Abteil vorbeigedrängt hatten. Als er seine Sachen beisammen hatte, öffnete er die Tür zum Gang und schob sich direkt vor einer älteren Dame hinaus.
»Müssen Sie so drängeln, junger Mann? Haben Sie denn keine Achtung vor dem Alter?«
»Apropos Alter«, antwortete Adrian. »Wo wollen Sie denn in Ihrem Alter noch so eilig hin? Die Endstation erreichen Sie doch noch früh genug.«
Das ungläubige Kopfschütteln der Oma brachte ihn zum Lachen. Überhaupt fühlte er sich prächtig. Er war ein ganz neuer Mensch, seit … ja, seit er diesen merkwürdigen Armreif gekauft hatte.
*********************************************************************
 Timo Bader (Hrsg.)
Timo Bader (Hrsg.)
Geschichtenweber: Optatio Onyx – Wünsche des Verderbens
Hardcover, 240 Seiten
Web-Site-Verlag, 2005
Klappentext:
Ein Armreif aus Onyx, beseelt von einer bösen Macht …
Ruhelos, von einem dunklen Fluch vorangetrieben, wandert er durch die Welt. Weder die Tiefen des Meeres noch der raue Wind in den Bergen werden ihn jemals aufhalten können, einen Träger zu finden, der seinem Bann erliegen wird. Wenn sein dunkler, geheimnisvoller Glanz ruft, kann niemand an ihm vorüber gehen.
Vor vielen Jahrhunderten gerieten Worte in Vergessenheit, die unsere Urahnen einst in ihrem Herzen trugen:
»Sei gewarnt, Fremder, ihn an dich zu nehmen und mit einem unbedachten Wunsch zum Leben zu erwecken! Denn dann beginnt das finstere Spiel … Plötzlich wird das Undenkbare Wirklichkeit, und kein Verlangen ist zu bizarr, als dass du es vor ihm verbergen könntest … Prüfe deinen Wunsch, Unglücksseliger, denn er könnte in Erfüllung gehen! Verflucht ist er und verflucht sei deine Arroganz, ihn für ein Geschenk der Erde zu halten – den Stein der Egoisten. Verlasse dich nicht auf das Glück, das er dir schenken wird – hast du doch ebenso das Unglück heraufbeschworen …«
Dunkel ist der Fluch, den der Armreif birgt. Jeder Wunsch erfährt eine schreckliche Entstellung. Und jeder Traum, den er erfüllt, führt den Träumenden einen Schritt näher zum Abgrund …
Timo Bader: Das Erbe des Schlangenkönigs
Philipp Bobrowski: Das Über-Ich
Marion Charlotte Mainka: Und kein Makel ist an ihr
Claudia Hornung: Im Zeichen des dunklen Herrschers
Joachim Ranc: Die Zeit der schwarzen Tränen
Mandy Schmidt: Im Reich der Tukona
Claudia Donno: Der perfekte Mann
Ruth Borcherding-Witzke: Sisyphus
Marlies Eifert: Till, der Maler
Jörg Olbrich: Der Dicke und das Biest
Weitere Informationen, Leseproben und Rezensionen bei den Geschichtenwebern.
Bestellen beim Verlag
Bestellen bei Amazon
Gefällt mir Wird geladen …